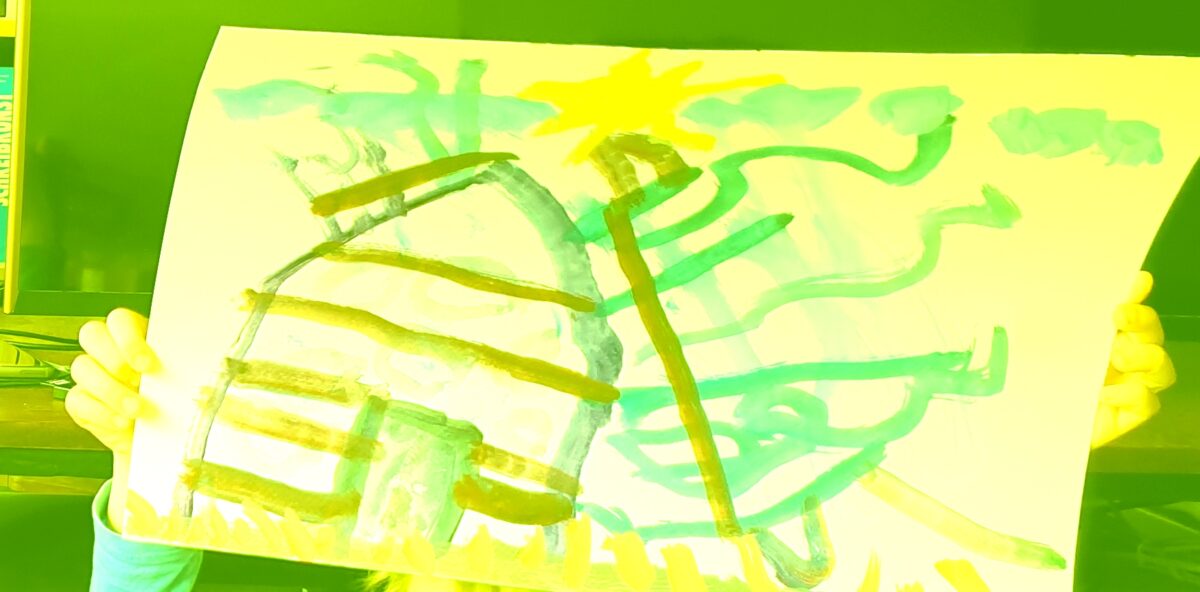
Ich lebe ein Leben, das ich nie wollte. Seit über 10 Wochen jetzt betreuen mein Partner und ich unser Kind zu Hause. Zusätzlich zu unserer Arbeit, klar. „Nebenher“. Unser Kind ist viereinhalb Jahre alt und sehr aufgeweckt, und es fordert viel Aufmerksamkeit. Seit ich vor etwa 6 Wochen einen Hilferuf absetzte, weil ich nicht mehr wusste, wie ich mit der Überforderung anders klar kommen sollte, werden wir 3-4 Mal in der Woche unterstützt von Freund*innen, die dann das Kind für 2 Stunden übernehmen. Die Freund*innen leben mit uns im gleichen Haus und nehmen wie wir die Kontaktbeschränkungen äußerst ernst.
Kinder, Küche, Kompromisse
Als ich mich 2014 dafür entschieden habe, dass ich ein Kind möchte, war das eine knappe Entscheidung. Man könnte fast sagen, dass ich ein Kind „in Kauf genommen habe“. Ich war 34 und wusste, dass unsere Gesellschaft Kinder nicht besonders wertschätzt. Kinder werden als Makel im Lebenslauf wahrgenommen, als Zeit- und Geldfresser, als Wesen, die dir Jugend, Sexdrive und Partynächte rauben und sie ersetzen durch Kackwindeln, Kindergeburtstage und einen gebeugten Rücken vom vielen Katzbuckeln in alle Richtungen: Damit du überhaupt die dir gesetzlich zustehende Kinderbetreuung bekommst, damit dir das Elterngeld auch wahrhaftig ausgezahlt wird, damit du in einem Restaurant sein darfst mit deinem Kind, damit du in deinem Job weiterarbeiten darfst, man stelle sich das mal vor. Ich hatte außerdem Angst vor den physischen Veränderungen der Schwangerschaft, scheute die Verantwortung, die Eltern nie wieder ablegen können, macht euch da nichts vor. Und vor dem systemischen Sexismus, dem Mütter anders und mehr ausgesetzt sind als kinderlose Frauen. Und Mütter natürlich gänzlich anders als Väter. Ich nahm das damals in Kauf, weil wir uns ein Kind wünschten. Und wir lieben es sehr. Es ist das beste Kind der Welt.

Aber es war eine durchaus knappe Entscheidung. Und hätte ich gewusst, dass irgendwann der Zeitpunkt kommen würde, wo wir uns auf keine Unterstützung mehr verlassen können, ich hätte mich dagegen entschieden.
Corona bringt es an den Tag
Und dann kam Corona, und es ist soweit: Es gibt keine Unterstützung mehr. Wir Eltern vegetieren seit bald einem Vierteljahr (gebt euch das mal, bitte!) in unseren Familienhöhlen und sollen alles gleichzeitig machen, wenn wir auch künftig noch existieren wollen. Wir sollen arbeiten und die Kinder betreuen, dabei hübsch still sein, wir wollen ja hier nicht die Revolution proben, und wer sich beschwert darf mit Whataboutismen rechnen wie „Was ist denn mit den Alleinerziehenden, den Alten, der Autoindustrie!?“ Und weil wir ja wirklich wissen, dass es gerade anderen Menschen auch schlecht geht und einigen natürlich auch schlechter als uns, halten wir mehrheitlich die Klappe. Ich habe von Müttern (sic) gehört, die zwischen 5 und 7 Uhr am Morgen arbeiten, um danach die Kinder betreuen zu können. Ich habe von inoffiziellen Spielabsprachen erfahren. Ich habe von Nervenzusammenbrüchen gehört. Und von Suizidgedanken.
Unvorstellbar? Dann stell dir vielleicht mal vor, alle 15 Minuten klingelt ein Wecker. Wenn er klingelt, musst du eine zufällige Aufgabe machen, zum Beispiel ein Brot buttern, ein albernes Spiel spielen, kneten oder ein Buch vorlesen, mit einer 50%igen Chance, dass du die Geschichte so richtig scheiße findest. Und das musst du mit einem Lächeln tun und voller Liebe. Von 7 Uhr am Morgen bis 8 Uhr am Abend. Du darfst für eine Weile den Wecker ignorieren, aber dann musst du die ganze Zeit über darüber nachdenken, was für ein schlechter Mensch du bist und wie du die Leben aller Menschen langsam zerstörst, die du liebst.
Und das machst du jetzt bitte neben dem Job, dem Haushalt und dem ohnehin ständig drückenden Stress durch eine weltweite Pandemie – und du machst das bitte 10 Wochen lang, ohne, dass Besserung in Sicht wäre. Herzlich Willkommen in meiner Welt.
Vor inzwischen einem Monat forderten Sozialverbände und Kinderärzt*innen die Politik zum Handeln auf. Und seit Monaten wird versprochen, dass sich um die Kinder und auch um die Eltern gekümmert wird. Bisher ist dabei herausgekommen: Nichts. Notbetreuung. Lippenbekenntnisse. Von 300 € „Sonderzahlung“ wurde gesprochen. Was soll ich mit 300 €? Dafür kann ich mir keine neuen Nerven kaufen. Genausowenig übrigens, wie man sich von 150 € einen Laptop kaufen kann.

Ja sorry, dass ich kein Auto geboren habe. Da würde ich jetzt Finanzspritzen, Konjunkturankurblungsversuche und ganz viel Beachtung von Politiker*innen hinterhergeschmissen bekommen. Schuldigung auch, dass Kinder keine Airline sind, die die Umwelt seit Jahrzehnten durch fehlende Ausgleichszahlungen bescheißt und jetzt gerettet werden muss mit Milliarden – ganz legal natürlich, Umwelt ist ja als Ressource quasi nicht bezifferbar und darum wird da auch nicht bezahlt für. Duh. Kinder sind ja nur die langweiligen Steuerzahlenden von morgen, blabla, das Argument haben die Kinderlosen schon so oft gehört, es wird einfach nicht geiler, wenn ich es wiederhole. Es verliert aber auch nicht an Relevanz.
Aber ich schweife ab, wir wollen ja konstruktiv bleiben. Vorbildliche Eltern sozusagen.
Der neue Riss durch die Gesellschaft
Also stelle ich nüchtern fest: Ein Riss, der schon seit langem durch die Gesellschaft geht, und der von vielen der Einfachheit halber ignoriert wurde, ist jetzt unübersehbar geworden: zwischen Eltern und Kinderlosen.
Wenn Wigald Boning versteht, was jetzt getan werden muss, aber die Kanzlerin nicht. Wenn der Profifußball für einige wichtiger ist als eine zumindest zeitweise geregelte Betreuung für kleine Kinder. Wenn der Gender-Rollback läuft und läuft, nur nicht für alle gleichermaßen. Wenn sich manche Gedanken machen können, welches ausgefallene Brotrezept sie als nächstes ausprobieren oder welchen tollen Corona-Skill sie als nächstes lernen oder welches Workout sie am effektivsten zu Hause schaffen können – und andere unter der Dusche zusammenbrechen, weil sie ihr Kind lieben, aber einfach nicht mehr rund um die Uhr ertragen, weil sie gute Eltern sein wollen, aber nicht mehr wissen, wie das gehen soll, weil den letzten Rest an Geduld verbraucht haben und sie trotzdem ruhig und besonnen handeln müssen, wenn ihr Kind durch eine Trotzphase geht, die nun einmal dazugehören zum Kindsein.
Wir Eltern können nur so gut sein, wie wir Unterstützung haben: Bedingungslose Akzeptanz, radikale Hilfe, kreative Angebote. Von alledem ist gesellschaftlich nichts zu sehen. Das ist eine Schande und eine Tragödie. Und es darf nicht so bleiben. Denn die Reserven sind bei zu vielen schon lange aufgezehrt.
Darum appelliere ich an die Politik, aber auch jede einzelne Person: Tut endlich etwas! Schaut nicht weg, solidarisiert euch. Unterstützt die, die schon zu lange keine Kraft mehr haben, aufzubegehren. Seid kreativ, seid hilfsbereit, zeigt Akzeptanz. Denn wir sind am Ende unserer Kräfte angekommen.
Nachtrag, 28.05.2020:
Ich habe jetzt einige Male gelesen, ich solle mich nicht anstellen. Manche schreiben das als Helden-Elternteil, das sich ganz aufgibt für das Kind und sich in die Situation so positiv einfügt wie möglich. Wenn das deine Vorstellung eines erfüllten Lebens ist, dann ist das ja schön, aber diesen Lebensentwurf allen Eltern aufoktroyieren? Also bitte. Da war unsere Großelterngeneration ja weiter.
Andere möchten mir das Recht absprechen, mich für ein Kind entschieden zu haben. Ach, Jon Snow, you know nothing. Nichts über mich, über meine Situation, meine Partnerschaft. Es sei gesagt: Ich habe mir diese lebensverändernde Entscheidung sicher nicht leicht gemacht, was unter anderem Sichtbar ist anhand des Fakts, dass ich über 30 Jahre gewartet habe. Kommentare wie „dann hättest du halt kein Kind kriegen sollen“ disqualifizieren sich meiner Ansicht nach ohnehin selbst, denn was bitte ist die Alternative? Dass staatliche Stellen ab jetzt entscheiden, wer Kinder kriegen darf und wer nicht wertvoll, stabil oder wohlhabend genug dafür ist? Oder doch lieber dahergelaufene Kommentator*innen in Blogs? Derartige Argumentationsmuster lassen keine sinnvolle Diskussion zu und dienen nur der Herabwürdigung meiner Person und anderer Eltern.
Diskursiv vorgebildete Personen würden sich auch nicht in Täter-Opfer-Umkehr verheddern und mir die Schuld dafür geben, dass es mir (wie vielen anderen) mit der Situation schlecht geht. Positives Denken bringt nur so lange weiter, so lange es sich nicht vollständig von der Realität entkoppelt.

Ich werde künftig keine Kommentare mit diesen Inhalten mehr freischalten. Wenn du also gerade ansetzen willst und etwas in dieser Art in deine Tastatur klopfen willst: Du kannst dir die Mühe sparen. 🙂




